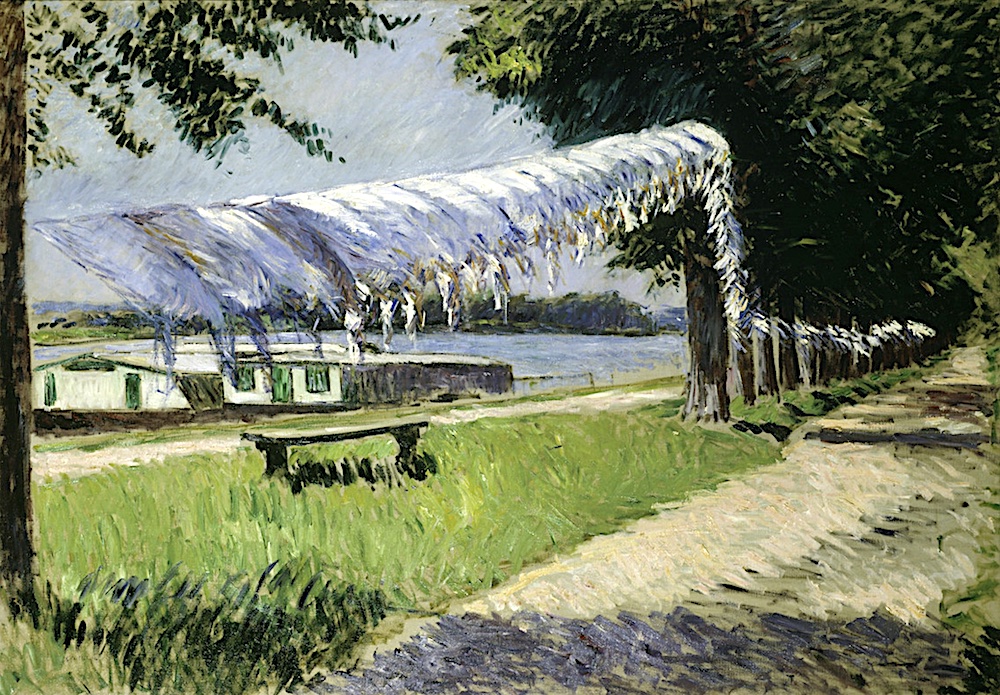Aneignungskunst und die Kunst der Aneignung
„Das Atelier ist zwischen den Menschen“
(Joseph Beuys)
Vor einigen Jahren erregt der New Yorker Designer Marco Castro Cosio Aufsehen mit einer Kunst-Leben-Initiative der besonderen Art. Entnervt von der „delirierenden Vertikalität“ (Baudrillard: Kool Killer, 35) aus Stahl, Glas und Beton, die seine Heimatstadt architektonisch dominiert, kommt er auf die Idee, brachliegende urbane Flächen zu begrünen. Die sollen allerdings nicht etwa auf den Dächern von Wolkenkratzern, sondern auf denen von Nahverkehrsbussen der New Yorker Metropolitan Transportation Authority liegen. Mit seinem Projekt Bus Roots verfolgt Cosio die Absicht, dem Big Apple mittels tausender bewegter Gärten wieder zu mehr Lebendigkeit und Schönheit zu verhelfen. Dass er damit auch die Busse selbst zu Kunstgegenständen macht, ist im Grunde genommen tautologisch. Schließlich sind Objekte auf vier Rädern seit Marinettis Futuristischem Manifest schöner als die Nike von Samothrake.
Tatsächlich ist dem New Yorker der ästhetische Wert, den seine Aneignung des öffentlichen Raums vermittelt, ebenso wichtig wie die konkrete Verbesserung der Lebensqualität, die eine urban nomadic agriculture mit sich bringt. Er unterstreicht dabei besonders die Momente des Mobilen und Spielerischen als kunstvolle Sidesteps, um die Statik und den heiligen Ernst vorgegebener Strukturen ins Leere laufen zu lassen. Bruder im Geiste ist ihm hier der Soziologe Michel de Certeau mit seinen „verkannten Produzenten, Dichtern ihrer eigenen Angelegenheiten und stillschweigenden Erfindern eigener Wege durch den Dschungel der funktionalistischen Rationalität“ (Certeau: Kunst des Handelns, 21). Wichtig ist dem Interaktionsdesigner dabei vor allem eins: die urbanen Gärten auf den Straßen der Metropole als kreatives Medium zu begreifen, als Medium der Kommunikation zwischen den Bürgern und ihrer Stadt – eine Poetry in Motion ohne Worte, aber ganz sicher mit einer Sprache, bodenständig und versatil zugleich. Bus Roots stehen also explizit für das Gegenteil dessen, was sich im Wortsinn der naheliegenden Sentenz Lass Gras drüber wachsen verbirgt.
Unter genau diesem Motto bemächtigen sich Urban Hacker in einer Mainacht 2014 einer Erhebung unbestimmter Funktion, die als Manifestation der Anti-Ästhetik zwischen Bahnsteig 1und 2 des Bahnhofs Köln-Ehrenfeld kauert. Da sie entfernt an die Betonautoskulptur Ruhender Verkehr von Wolf Vostell auf dem Kölner Hohenzollernring erinnert, wird sie in der Ehrenfelder Folklore gemeinhin RV2 genannt. Die Aneignungskünstler, die in ihrem Atelier Öffentlicher Raum mit viel Verve ans Werk gehen, machen in besagter Nacht aus dem enigmatischen Klotz eine grüne Oase. Es sind weder die hängenden Gärten von Babylon noch die fahrenden Gärten von New York. Aber leuchtend grüne Farbe, wo vorher nur Grau war und die weiße Aufschrift Lass Gras drüber wachsen verändern Anmutung und Stimmung auf dem Bahnsteig signifikant.
Am darauffolgenden Mittag stehen Menschen vor dem nun zum urbanen Kunstobjekt mutierten Pseudo-Bunker. Die Veränderung fällt auf, weckt Erstaunen und regt zu Diskussionen an. Dem neuen belebenden Element wird offenkundig Sympathie entgegengebracht. Der Versuch, die gelungene Appropriation am nächsten Tag im Bild festzuhalten, kommt leider schon zu spät. Die Metamorphose des Betonblocks, der sich, wie das gesamte Bahnhofsgelände, offenkundig im Besitz der Deutschen Bahn AG befindet, stößt bei den Verantwortlichen vor Ort nicht auf Wohlwollen. Entsprechend entschlossen wird gehandelt, es wächst definitiv kein Gras über die Sache. Schnell stellt die robuste Übermalung in einem ebenso monochromen wie diffusen Braun die dezent depressive Ausstrahlung des Vorgängers wieder her: Mission completed, appropriation deleted.
Was will uns der Autor damit sagen? Vielleicht, dass der öffentliche Raum ein künstlerisches Medium ist wie eine Leinwand oder eine Fotografie. Dass die künstlerische Freiheit zwangsläufig an die Grenzen derer stößt, die wollen, dass die Dinge, von denen sie glauben, dass sie ihnen gehören, so bleiben wie sie sind. Dass diese Dinge fast alles sein können – Bilder, Skulpturen, Straßen, Plätze und ja, natürlich auch Marken – und dass in diesem Kontext fast alles Kunst sein kann und fast jeder ein Künstler. Zumindest jeder Mensch, der sich, im Sinne von Joseph Beuys, als „sich selbst bestimmendes Wesen, als Souverän schlechthin versteht und da, wo er seine Fähigkeiten entfaltet, zum Künstler wird“ (Brügge: Interview mit Joseph Beuys, 23).
Welchen optionalen Verlauf hätte der Aneignungs-Tatort Bahnhof Ehrenfeld denn nun nehmen können, wenn das Drehbuch eine andere Dramaturgie und andere Protagonisten vorgesehen hätte? Welche Alternativen wären zu der harschen Reaktion, die doch eher freundliche Übernahme beinahe in Echtzeit wieder auszulöschen, vorstellbar gewesen? Als erste Alternative drängt sich hier die sattsam bekannte Strategie auf, sich nicht zu verhalten – zumeist deshalb, weil man das, was sich an der Peripherie oder auch gleich vor der eigenen Haustür tut, gar nicht wahrnimmt, sei es aufgrund kultureller Sehschwäche oder weil es wirklich nicht stört. Oder weil man zwar auf der Analyse- und Erkenntnisebene stark, auf der Handlungsebene aber inkonsequent ist, also bequem, lethargisch, höchstens stark im Gras-darüber-wachsen-lassen. Fehlende Konsequenz kann man denen, die das Grün so humorlos wie effizient entfernten, sicher nicht vorwerfen. Sie haben ihrem Selbstverständnis gemäß gehandelt und die künstlerische Guerilla-Aktion als Angriff auf ihre Autorität interpretiert, als Markenrechtsverletzung, wie man in einem ökonomisch-juristischen Zusammenhang sagen würde.
Aber wir haben ja noch Alternative zwei im Angebot: die Akzeptanz, den Schulterschluss, im besten Falle sogar die Ermutigung. Warum sich die Dinge nicht erst einmal in Ruhe anschauen, den Zeichen lauschen? Warum das Neue nicht als Möglichkeit begreifen, als kreative Intervention des Systems zum Wohle aller, letzthin als Gesprächsangebot im öffentlichen Raum? Eine entspannte, souveräne Haltung, mithin die, die sich einem Souverän geziemte, läse sich dann so: „Uns gefällt das, was ihr macht. Macht noch mehr. Ihr seid die Kreativen. Wir brauchen euren Input. Aber wenn ihr zu viel macht, lasst uns darüber reden!“
„O brave new world that has such people in’t”, wie Shakespeare in seinem Sturm (V, i) so schön sagt. Die Realität sieht nämlich oft anders und trüber aus. Davon kann die Appropriation Art, die Kunst, sich Kunst anzueignen und daraus neue Kunst zu machen, ein Lied singen. Ein Lied, das inzwischen sicher auch schon wieder gesampelt und remixed worden. Die Strategien dieser historisch in den 1980er-Jahren verorteten Kunstrichtung stehen nämlich mittlerweile „im weiteren Sinne für einen omnipräsent gewordenen kreativen Schaffensmodus, der inzwischen alle Bereiche künstlerischer Praxis erfasst“, wie Anna Blume Huttenlauch schreibt (Huttenlauch: Nimm mich, 1). Für die Appropriation Art ist alles Material und Vorlage, das dazu einlädt, dekontextualisiert, neu arrangiert und interpretiert zu werden. Deshalb sind juristische Probleme vorprogrammiert, kollidiert das Recht auf künstlerische Freiheit doch zwangsläufig mit dem Urheberrecht, das Werte wie Innovation, Kreativität und Originalität schützt. Dazu nochmals Huttenlauch (Huttenlauch: Nimm mich, 2): „In juristischer Hinsicht ist Appropriation Art darauf angewiesen, dass der Rechteinhaber des benutzten Werks der Wiederverwertung entweder ausdrücklich zustimmt, sie zumindest billigt oder gar nicht erst davon erfährt“. Ähnlichkeiten mit weiter oben geschilderten Beispielen sind keineswegs zufällig und ausdrücklich gewollt.
Dass, was der Aneignungskunst bis heute ihre Sprengkraft verleiht und sie im vorliegenden Kontext so spannend macht, ist ihr furchtloses Fragen nach der Berechtigung der hohen Güter Autorschaft, geistiges Eigentum und immer wieder Originalität. Sie alle sind dem romantisch-klassischen Geniebegriff des 19. Jahrhunderts verpflichtet, rekurrieren auf den großen schöpferischen Akt, in dem alles Bedeutende, Schöne, Gute und Wahre entsteht. Dass die strategische Aneignung fremder Vorlagen, die bewusst und ausdrücklich die Inszeniertheit des Vorgehens betont, einen großen künstlerischen Eigenwert besitzt, der sich kulturell anderweitig verortet, betont Douglas Crimp: „Needless to say, we are not in search of sources or origins, but structures of signification: underneath each picture there is always another picture“ (Crimp: Pictures, 186).
Es geht also letzten Endes um Bedeutung und die Multiplikation von Bedeutung. Die gebiert sich nicht daraus, dass die angeeigneten Kunstwerke, Texte, Gegenstände oder Produkte autonom und hermetisch sind, sondern vielschichtig und dass zwischen den vielen Schichten viel Platz für neue Bedeutungen ist. Für den, der einmal Moby Dick von Herman Melville gelesen hat, ist ein weißer Wal nicht nur ein weißer Wal, sondern eine Metapher für den einsamen Kampf des Menschen gegen die Natur. Für die ist ein Bahnhofsrelikt aus Beton, das an eine Vostell-Skulptur erinnert, selber ein kurzes Dasein als Kunstwerk fristet, um dann gleich wieder entzaubert zu werden und trotzdem in das Aneignungsnarrativ einer bestimmten Community einzugehen, mehr als nur ein Stück Beton, sondern ein beziehungsreiches Artefakt. Sherrie Levine schildert das Wesen ihrer künstlerischen Arbeit ähnlich: „Ich wollte in sich selbst widersprüchliche Bilder herstellen. Ich wollte ein Bild über ein anderes legen, so dass man mal beide Bilder sehen kann und mal beide Bilder verschwinden […]. Energie wird durch die Interaktion zwischen Dingen aufgebaut. Eins und eins ergibt nicht immer zwei, sondern manchmal fünf oder acht oder zehn“ (Levine: Why I appropriated, 85).
Angeeignete Dinge werden komplex und mehrdeutig, sie beginnen ein Eigenleben zu führen, in dem sich alles, Schicht für Schicht, wie in einem Palimpsest aufeinander bezieht und nicht nur den angeeigneten Gegenstand, sondern auch den Appropriateur verändert. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Weder sind die Fragen einfacher noch die Antworten klarer geworden. Ist letzten Endes nicht die Kopie das Original? Warum ist ein Zitat weniger originell als ein Satz von mir, von dem ich nicht weiß, ob und wann ich ihn nicht vielleicht auch schon irgendwo gelesen habe: „Zitieren“, sagen die Kabylen, „ist wiederbeleben“ (Fraser: Zitieren, 87).
Und um Lebendigkeit geht es ja hier, um die subtile Kunst des Spielerischen, die kreative Kolonisierung der Zwischenräume, die generative Kraft des Unernsten im Kampf gegen die Langeweile des Konfektionierten. Appropriation Art im Sinne eines sehr weit gefassten, entgrenzten Kunstverständnisses ist ein Plädoyer für Vielfalt, Heterogenität und Polyvalenz, aber auch für die Relativierung tradierter Wertigkeiten und Hierarchien. Auch sie selber hat den Stein der Weisen nicht gefunden und sucht ihn auch gar nicht. Wahrheit und Bedeutung liegen vielmehr im Dazwischen – so wie das Atelier zwischen den Menschen liegt – und sie gehören keinem. Michalis Pichler darf in seinem 18. Statement on Appropriation diesbezüglich den letzten Wirkungstreffer setzen: “No poet, no artist, of any art has his complete meaning alone.”
Literatur
Acker, Kathy: Ultra light – last minute-ex+pop-literatur. Hg. von Almuth Carstens und mit einem Interview von Sylvère Lotringer, Berlin 1990.
Baudrillard, Jean: Kool Killer oder der Aufstand der Zeichen, Berlin 1978.
Baumgärtel, Tilman: Innovative Amateure an den Schnittstellen von Kunst und Medien. Unter http://www.heise.de/tp/artikel/13/13975/1.html, 2003.
Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt/Main 1963.
Beuys, Joseph und Ende, Michael: Kunst und Politik – ein Gespräch, Wangen 1989
Brügge, Peter: Die Mysterien finden im Hauptbahnhof statt. Interview mit Joseph Beuys über Anthroposophie und die Zukunft der Menschheit. In: Der Spiegel 23, 1984.
Buss, Esther, Graw Isabelle und Krümmel, Clemens: Vorwort. In: Appropriation Now! Texte zur Kunst, Berlin 2002, 4-6.
de Certeau, Michel: Kunst des Handelns, Berlin 1988.
Crimp, Douglas: Pictures, New York 1977.
Fraser, Andrea: „Zitieren“, sagen die Kabylen, „ist Wiederbeleben.“ In: Appropriation Now! Texte zur Kunst, Berlin 2002, 86-92.
Huttenlauch, Anna Blume: Nimm mich – Appropriation Art. Unter www.artnet.de/magazine/appropriation-art, 2006.
Jaeggi, Rahel: Aneignung braucht Fremdheit. In: Appropriation Now! Texte zur Kunst, Berlin 2002, 60-70.
Levine, Sherrie: Why I appropriated. In: Appropriation Now! Texte zur Kunst, Berlin 2002, 84-85.
Pettauer, Ritchie: Geistiges Eigentum rekombinieren. Unter http://www.heise.de/tp/artikel/24/24034/1.html, 2006.
Pichler, Michalis: Statements on Appropriation. Unter www.ubu.com/papers/pichler_appropriation.html, 2009.
Zuschlag, Christoph: Die Kopie ist das Original – Über Appropriation Art: In: Ariane Mensger (Hg.): Déjà-vu? Die Kunst der Wiederholung von Dürer bis YouTube, Kerber-Verlag Bielefeld 2012, 126-135.