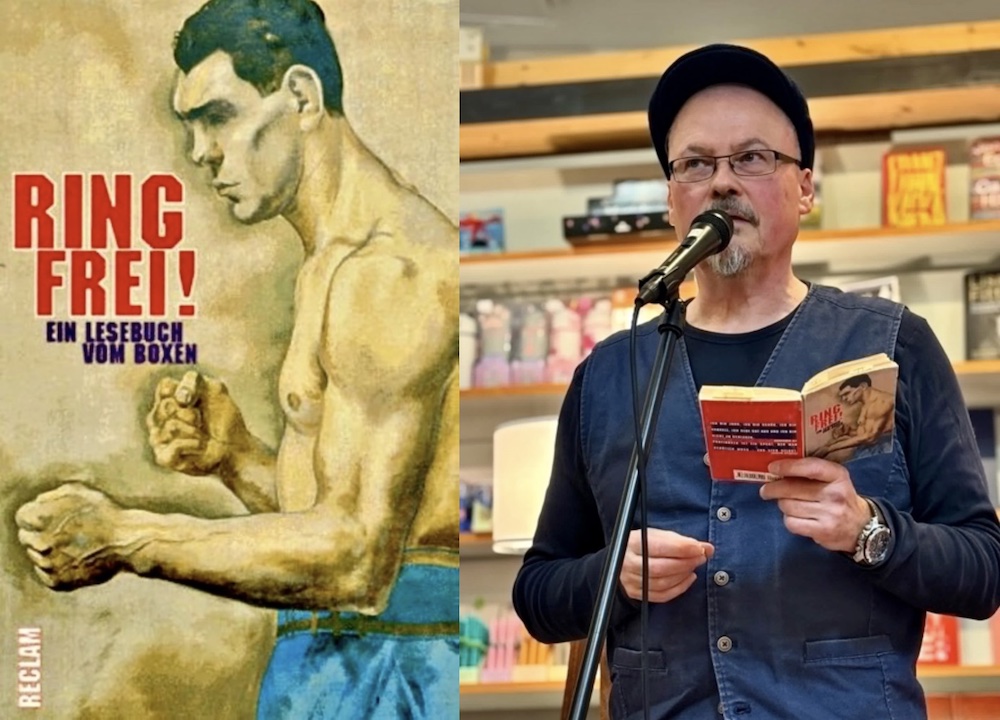„Mit uns beginnt die Herrschaft des von seinen Wurzeln abgetrennten Menschen. Die des vervielfältigten Menschen, der sich mit Eisen vermischt und von Elektrizität nährt. Bereiten wir die bevorstehende Verschmelzung des Menschen mit dem Motor vor!“
Dieser radikale Imperativ ist älter, als man auf den ersten Blick vermuten möchte. Er entstammt dem Futuristischen Manifest von 1910, und Marinetti zeichnet dafü r verantwortlich. Die italienischen Futuristen verstanden sich als Kritiker ü berkommener Kunst- und Gesellschaftsvorstellungen und pflegten die Stilisierung ihres provokanten Habitus. Obwohl sich viele dieser technikgläubigen und geschwindigkeitsverliebten Erneuerer durch fragwürdiges politisches Engagement diskreditierten, hat ihre Botschaft das Denken des 20. Jahrhunderts entscheidend geprägt. Der Mensch ist nicht mehr, wie es die Antike so vorbildlich formulierte, das Maß aller Dinge, sondern partiell ersetzbar im Denken und Handeln. Ersetzbar durch die Maschine! Hierin manifestiert sich eine existentielle Urangst des homo sapiens, aber gleichzeitig auch das Phantasma von der unbegrenzten Optimierbarkeit des menschlichen Körpers und seiner Leistungsfähigkeit. Mensch – Natur – Technik, das magische Dreieck unserer Zeit, fand sich nicht zufällig als Motto der EXPO 2000 wieder. Die deutsche Gruppe Kraftwerk, anerkannter Pionier der elektronischen Musik und Referenzobjekt für fast alle Techno-Avantgardisten der letzten Jahre, hat dieses Motto für die Weltausstellung vertont. Eines ihrer berühmtesten Frü hwerke trä gt den Titel Die Menschmaschine. Hier schließt sich der Kreis und wirft gleichzeitig eine weitere Fragestellung auf: Wie verhält es sich mit der Sehnsucht des Menschen nach dem Ursprü nglichen, Kö rperlichen und Sinnlichen im Zeitalter der Virtualitä t? Gibt es einen Gegenentwurf zur Ideologie des Artifiziellen? Die Faszination des Internets, dieser tiefgreifenden Revolution des Informationsflusses und des Diskurses, lässt eine solche Frage nur umso akzentuierter hervortreten.
Ein interessantes Phä nomen stellt in diesem Zusammenhang der unglaubliche Erfolg der Ausstellung Körperwelten dar. Mehr als 700.000 Besucher hat dieses kontrovers diskutierte Ereignis bis dato zu verzeichnen. Prof. Gunther von Hagens zeigt in seiner postmortalen Präsentation über 200 sogenannte menschliche „Plastinate“, sowohl ganze Körper als auch einzelne Organe und transparente Körperscheiben. Der menschliche Körper als Exponat – diese Tatsache bedarf ebenso einer Legitimation wie die Faszination auf zahlreiche Besucher einer Erklä rung bedarf. Das Motto der Ausstellung, die Faszination des Echten, gibt den entscheidenden Hinweis. Es arbeitet mit der Suggestion der Vermittlung wahrhafter und wirklicher Erfahrungen. Wer den Mut besitzt, sich dem Anblick „echter“, konservierter Menschen auszusetzen, wird durch Authentizitätserlebnisse in einer Epoche der Virtualität belohnt. Hier ist alles konkret sichtbar, fühlbar und plastisch, so scheint es. Die Sensation präsentiert sich als Information mit der Absicht der Aufklärung.
Das „Aufklärung der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit ist“, wissen wir seit Kant. Aber was ist das Echte? Durch das von Hagens entwickelte Verfahren der Plastination wird das Wasser der Gewebeflü ssigkeit durch spezielle Kunststoffe ersetzt. Aber ist der Kunststoff nicht das Paradigma des Artifiziellen? „Plastik ist weniger eine Substanz als vielmehr die Idee ihrer endlosen Umwandlung, ist eine plötzliche Konvertierung der Natur“, s c h r e i b t R o l a n d B a r t h e s . W e n n m a n d a s E c h t e a l s d a s N a t ü r l i c h e d e f i n i e r t , u n d w a s i s t natü rlicher und kreatü rlicher als der menschliche Leib, wird hier ein fundamentales Missverständnis evident. Ebenso in der Künstlichkeit des Arrangements. Die „Plastinate“ – der Begriff als solcher tradiert ohnehin schon eine unreflektierte und inhumane Wissenschaftsterminologie – sind nach Hagens in „lebensnaher Haltung positioniert.“ De facto sind die Skulpturen wie der Hautmensch, der Fechter oder der Läufer androide Skulpturen, die ihres Rechts auf Selbstbestimmtheit verlustig gegangen sind.
Natürlich ist die Ausstellung unter www.koerperwelten.de auch im Internet zu besuchen. In der virtuellen Präsentation des vorgeblich Echten findet also nochmals eine Potenzierung des Künstlichen statt. Denn bei aller Würdigung der Möglichkeiten, die uns dieses neue Medium an die Hand gibt, darf eines nicht vergessen werden: Sinnliche Erfahrungen sind fü r die Ausbildung von Humanität unverzichtbar und durch nichts zu ersetzen.
Die Körperwelten haben das Ungenügen des modernen Menschen an seiner entsinnlichten und entkörperlichten Existenz seismographisch aufgespürt, ohne jedoch den musealen Blick zu transzendieren. Als Resümee dessen, was wir Menschen in der virtuellen Epoche bewahren müssen, sei abschließend Pere Duran Farell, Mitglied des Club of Rome, mit seiner zeitlosen Bemerkung aus den 1980er-Jahren zitiert: „Was bleibt uns also? Es bleiben unsere Gefühle, unsere Freiheiten, Widersprüche, unsere Unordnung, unser Bedürfnis nach Liebe und die Anforderungen dessen, was wir fü r absurd halten.“
Manfred Luckas
Manfred Luckas: Homo cyber? Mensch, Maschine und Virtualität. In Cyber-Trend.de – Ein Barometer der Cyber-Kultur. Essays. Hg. von Jörg Krichbaum und Manfred Luckas. Edition Arcum, Köln 2001, S. 8-10.